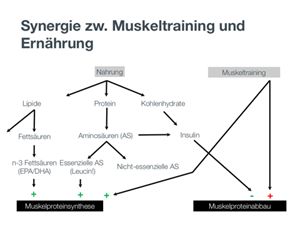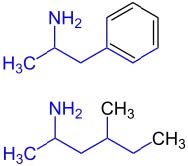Wenn ein Training effektiv sein soll, so sollen zu seiner Realisierung folgende Trainingsprinzipien angewendet werden. Diese haben eine hohe Bedeutung, wenn es um Planung und Gestaltung des sportlichen Trainings geht.
Trainingprinzip 1: Prinzip des wirksamen Belastungsreizes
Dieses Prinzip besagt, dass es für die Trainingswirksamkeit eines Reizes wichtig ist, dass dieser eine bestimmte Schwelle überschreiten muss, wenn er zu Anpassungserscheinungen führen soll. Unterschwellige Reize führen zu keiner Anpassung und bleiben wirkungslos.
Geben Sie also Gas beim Training!
Trainingsprinzip 2: Prinzip der progressiven Belastungssteigerung
Der Belastungsreiz muss sich dem Trainingszustand des Sportlers anpassen. Immer gleiche Belastungsreize verlieren im Laufe der Zeit ihre Wirkung im Hinblick auf die Leistungsverbesserung. Die Belastungen müssen von Zeit zu Zeit dem neuen Funktionszustand angeglichen werden. Um eine weitere Leistungssteigerung zu bewirken, muss die Belastung progressiv (=ansteigend) sein.
Erhöhen Sie also die Intensität von Training zu Training!
Trainingsprinzip 3: Prinzip der Kontinuität
Die Reizeinwirkung auf den menschlichen Organismus muss über einen längeren Zeitraum erfolgen, wenn dadurch eine Leistungserhöhung erzielt werden soll. Ähnliche oder gleiche Reize müssen in den zeitlich richtigen Abständen immer wieder auf das System einwirken. Ist dies nicht der Fall, kommt es zur negativ verlaufenden Anpassung, welche mit Leistungseinbussen verbunden ist.
Folgendes ist zu beachten: Dauer für den Aufbau = Dauer für den Abbau. Jemand trainiert z.B. 3 Monate 3x pro Woche und stellt das Training anschliessend wieder ein. So dauert es ca. 3 Monate bis er sich wieder auf seinem Ausgangsniveau befindet.
Trainieren Sie also regelmässig (mind. 1 Training pro Woche)
Trainingsprinzip 3: Prinzip der Variation
Bei diesem Trainingsprinzip geht es um den gezielten Wechsel von
- Trainingszielen (motorische, kognitive, soziale etc.)
- Trainingsinhalten (allgemein entwickelnde Übungen, Spezialübungen, Wettkampfübungen)
- Trainingsmethoden (HIT, Dauermethode, Wettkampfmethode)
- Trainingsmitteln (Velo, Crosstrainer, Rudergerät etc.)
Trainieren Sie also unterschiedliche Komponenten Ihrer Fitness!
Trainingsprinzip 4: Prinzip der Periodisierung und Zyklisierung (nur für Sporarten wichtig)
Da sich die sportliche Form – über ein ganzes Jahr betrachtet – nicht auf einem Topniveau befinden kann, muss auch die sportliche Form über die Zeitspanne hinweg gezielt einem periodischen Wechsel unterzogen werden.
Unter Periodisierung versteht man die zyklische Gestaltung des Wettkampfjahres, wobei drei Perioden unterschieden werden.
Vorbereitungsperiode
Ziel: Entwicklung allgemeiner Leistungsvoraussetzungen und hoher allgemeiner Belastbarkeit.
Es geht darum, die einzelnen konditionellen Fähigkeiten nicht gemeinsam, sondern zeitlich und inhaltlich-methodisch aufeinander aufbauend zu entwickeln. In der Vorbereitungsperiode wird mit einem höheren Trainingsumfang trainiert.
Wettkampfperiode
Ziel: Ausprägung der komplexen Wettkampfleistung durch Wettkampfteilnahme.
In der Wettkampfperiode muss der Sportler wiederum zwischen wichtigen und weniger wichtigen Wettkämpfen unterscheiden. In der Wettkampfperiode wird versucht die Leistungsfähigkeit im konditionellen Bereich zu erhalten.
Übergangsperiode
Ziel: In der Übergangsperiode werden der Belastungsumfang und die Belastungsintensität verringert. Es kommt zu einem geplanten Formverlust.
Mikro-, Meso- und Makrozyklus
Um das Training noch präziser planen zu können, hat sich in der Praxis eine Einteilung in die Organisationseinheiten der Mikro-, Meso- und Makrozyklen bewährt. Dabei stellen im Trainingsplan der meisten Sportarten die Mikrozyklen eine kalendarische Woche dar. Die Mesozyklen dienen dabei der mittelfristigen Planung, da sie sich meist über Zeiträume von 4 -12 Wochen erstrecken. Der Makrozyklus dient der langfristigen Planung und erstreckt sich über die Dauer von 3 – 12 Monaten.